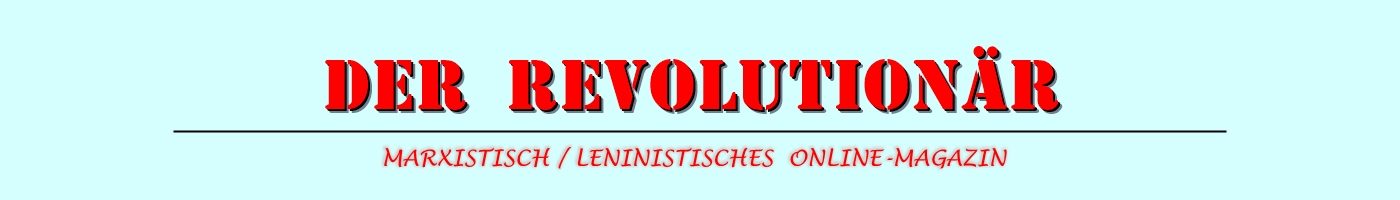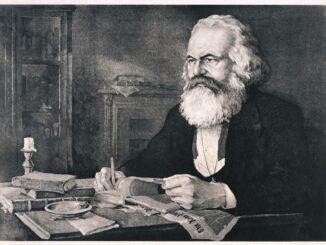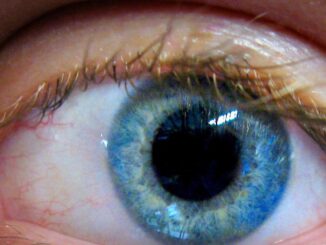Die Geburt der politischen Ökonomie und der technische Fortschritt
Obwohl die politische Ökonomie bereits gegen Ende des 17. Jahrhunderts in einigen genialen Köpfen entstand, wurde sie in ihrer positiven Form erst durch die Physiokraten und Adam Smith im 18. Jahrhundert voll ausgeprägt.

Von Heinz Ahlreip
1. Mai 2025
Die in diesem Jahrhundert einsetzende große technische und industrielle Revolution schuf die Voraussetzungen für eine kommunistische Gesellschaft im Wohlstand. Zum ersten Mal in der Geschichte war es möglich, die Produktion ins Unendliche zu steigern.
Die Illusion vom Überfluss der bürgerlichen Gesellschaft
Doch gerade diese Möglichkeit brachte eine Illusion mit sich: die Vorstellung, unsere bürgerliche Gesellschaft könne sich ohne tiefgreifende Krisen in eine Gesellschaft des Überflusses verwandeln. Eine zunehmende Proletarisierung sei demnach nicht gegeben. Lenin warnte im Oktober 1916 in seiner Schrift Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus vor der Gefahr einer arbeiteraristokratischen Abweichung, die die Wirklichkeit falsch widerspiegelt. Sozialdemokraten, Revisionisten, Opportunisten und kleinbürgerliche Theoretiker versuchen, uns Sand in die Augen zu streuen.
Der Widerspruch von gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung
Unsere Klassiker jedoch gingen stets davon aus, dass die sich immer schneller ablösenden Erfindungen und Entdeckungen zu einer täglich steigenden Produktivität menschlicher Arbeit führen. Das muss zwangsläufig zu einem Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung führen – ein Widerspruch, an dem die heutige kapitalistische Wirtschaft historisch scheitern wird.
Der Beitrag von Marx zur politischen Ökonomie
Es reicht jedoch nicht, die Emanzipation der Werktätigen einseitig auf den technischen Fortschritt der Großindustrie zu gründen. Ohne Marx wären wir orientierungslos geblieben. Er brachte mit seiner Analyse der politischen Ökonomie einen gewaltigen Fortschritt. Als klassische politische Ökonomie gilt jene seit William Petty, die den inneren Zusammenhang der bürgerlichen Produktionsverhältnisse erforscht. Die bürgerlichen Ökonomen erhoben es zum Dogma, dass Lohnarbeiter ihre Arbeit an Kapitalisten verkaufen. Doch damit kommen wir nicht weiter – wir drehen uns im Kreis. Diese falsche Annahme führte letztlich auch zur Auflösung der Ricardoschen Schule.
Die Entdeckung des wahren Tauschverhältnisses
Der Denkfehler liegt darin, dass die bürgerlichen Ökonomen den Arbeitswertbegriff auf die Ware „Arbeit“ selbst anwendeten: Arbeit sollte durch Arbeit bestimmt werden – ein unfruchtbarer Zirkelschluss. Wir geraten so in eine Sackgasse, aus der uns erst Marx befreite. Er erkannte: Der Arbeiter verkauft nicht seine Arbeit, sondern seine Arbeitskraft auf dem Warenmarkt. Nicht die Arbeit tritt dem Geldbesitzer gegenüber, sondern der Arbeiter selbst. Sobald er zu arbeiten beginnt, gehört ihm seine Arbeit nicht mehr.
Die besondere Ware: Arbeitskraft
Die Arbeit schafft allen Reichtum – und wurde dennoch fälschlicherweise als eine Ware mit einem eigenen Wert betrachtet.
„Dass in der Erscheinung die Dinge sich oft verkehrt darstellen, ist ziemlich in allen Wissenschaften bekannt, außer in der politischen Ökonomie“,
lehrt Marx im 17. Kapitel des ersten Bandes des Kapitals, das den Titel trägt: Verwandlung von Wert resp. Arbeitskraft in Arbeitslohn
(vgl. Karl Marx, Das Kapital, Werke, Band 23, Dietz Verlag Berlin, 1960, S. 557ff.; Zitat auf S. 559).
Erst durch Marx ist es möglich, von den Produktionskosten der Arbeitskraft auf ihren Wert zurückzuschließen – also die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zu bestimmen, die zur Herstellung einer bestimmten Qualität von Arbeitskraft nötig ist. Der Arbeiter wird ausgebeutet, weil seine Arbeitskraft eine besondere Ware ist – sie besitzt die Fähigkeit, Wert zu schaffen.
Der 1. Mai als Kampftag gegen Lohnsklaverei
Diese Quelle des Werts tritt seit 1890 jedes Jahr am 1. Mai, dem von der Sozialistischen Internationale als „Kampftag der Arbeiterbewegung“ ausgerufenen Datum, öffentlich in Erscheinung – als Erinnerung an das Massaker am Haymarket Square in Chicago am 1. Mai 1886. Heute gilt der 1. Mai als „Tag der Arbeit“. Seine Botschaft ist klar und laut: Der Lohnsklave wirft durch die Abschaffung der Lohnarbeit seine Fesseln ab. Das ist der unauslöschliche, wenn auch nicht unendliche, Auftrag zum Kampf.
Aktuelle Perspektive: Der 1. Mai 2025
Auch der 1. Mai 2025 zeigt: Es gibt wachsende, wenn auch noch zaghafte, Anzeichen, dass Arbeiter bereit sind, entschlossen gegen die kapitalistische Ausbeutungsordnung vorzugehen. Dieses Ziel ist nicht nur ökonomisch und politisch, sondern auch kulturrevolutionär motiviert.
Eine rote Woche der Solidarität und Kultur
Bedenkt man, dass der 5. Mai der Geburtstag von Karl Marx ist, ließe sich – bei Abschaffung sämtlicher christlicher Feiertage, dieser Überbleibsel eines aufklärungsfeindlichen Mittelalters und eines korrupten Klerus – eine rote, arbeitsfreie Woche vom 1. bis 5. Mai schaffen. In dieser Woche könnte anstelle kulturimperialistischer Verblödung die Kultur der Arbeiterklasse in den Massenmedien wieder sichtbar werden: mit Theaterstücken von Brecht, Liedern von Ernst Busch – präsent, aber nicht allbeherrschend.
Diese Woche stünde vor allem im Zeichen internationaler Solidarität, der Freude, der Aufklärung, der Jugend, der Spiele – und der öffentlichen Feste.
________________________
.