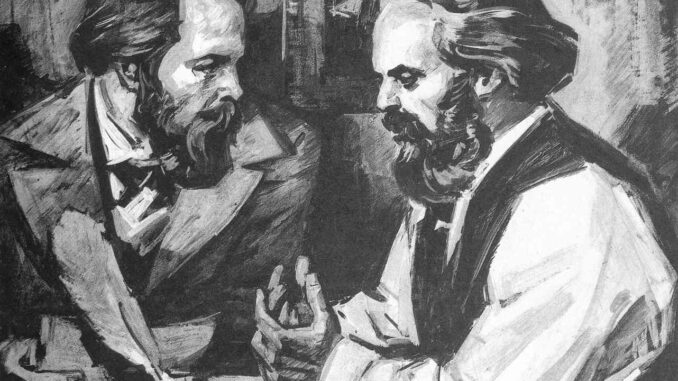
Im September 1843, gerade 25 Jahre alt, schreibt Karl Marx aus Bad Kreuznach an Arnold Ruge und bringt seine programmatische Haltung auf den Punkt:
„…fortschrittlichen Intellektuellen [müssen] aus den Prinzipien der Welt neue Prinzipien entwickeln und […] der Welt zeigen […], warum sie eigentlich kämpft.“
(Marx an Ruge, Kreuznach, im September 1843, Werke, Band 1, Dietz Verlag Berlin, 1960, S. 345)
Dieser aufklärerische Anspruch zieht sich durch sein gesamtes Schaffen: Warum existieren Klassenkämpfe? Und wie lassen sie sich ausführen?
Von Heinz Ahlreip – 12. April 2025 |
Das Kapital – Enthüllung des ökonomischen Bewegungsgesetzes
Das zentrale Werk, das diese Fragen beantwortet, bleibt bis heute »Das Kapital«. Ohne Marx‘ Analyse der kapitalistischen Produktionsweise wäre auch Lenins Imperialismustheorie undenkbar.
Der erklärte Zweck des Kapital ist es, das „ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft“ zu enthüllen. Marx geht davon aus, dass dieses Gesetz nicht offen zutage tritt. Die kapitalistische Gesellschaft basiert auf Warenproduktion, auf dem Austausch individueller Arbeitsprodukte. Die gesellschaftliche Dimension der Arbeit wird dabei nicht unmittelbar sichtbar, sondern vermittelt sich über den Markt.
Die Rolle des Geldes – Vermittler und Verschleierer gesellschaftlicher Macht
In dieser Logik nimmt das Geld eine Sonderrolle ein: Es wird zur universellen Ware, zum allgemeinen Äquivalent, scheinbar mit einer natürlichen Macht ausgestattet. Doch diese Macht ist keine natürliche Eigenschaft des Geldes – sie entspringt vielmehr seiner Funktion als Vermittler gesellschaftlicher Verhältnisse.
Gerade hierin liegt die ideologische Verschleierung: Geld verdeckt den gesellschaftlichen Charakter privater Arbeit. Marx’ Kapital reißt diesen Schleier auf – mit welchem wissenschaftlichen Ansatz?
Die Produktionsverhältnisse – Grundlage aller gesellschaftlichen Prozesse
Bereits im Januar 1859 legte Marx in der Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie den theoretischen Kompass seiner Methode offen und verpflichtete alle, die sich auf ihn berufen, auf diese Grundlage. Leider folgen nicht alle Marxisten dieser Linie konsequent, obwohl sich nur aus ihr die wissenschaftliche Qualität marxistischer Theorie ergibt:
„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein […]
Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt […]
Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein.“
(Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, Werke, Band 13, Dietz Verlag Berlin, 1960, S. 8f.)
Materialistische Methode – Die Dialektik als Werkzeug der Kritik
Mit anderen Worten: Die materielle Produktionsweise bildet die Grundlage aller gesellschaftlichen Verhältnisse – sozialer, politischer und geistiger Natur. Nur durch die Analyse dieser Produktionsverhältnisse lässt sich die Gesellschaft wissenschaftlich verstehen und verändern. Diese Analyse muss materialistisch erfolgen – mit der Dialektik als Methode.
Marx entwickelte seine materialistische Dialektik im bewussten Bruch mit der idealistischen Dialektik Hegels. Hegel hatte laut Lenin die Gesetze der Dialektik zwar „genial erraten“, jedoch missbraucht, um die bestehende Ordnung zu rechtfertigen. Marx hingegen entfaltete den „negativen Kern“ der Dialektik, um die Vergänglichkeit bestehender Verhältnisse zu zeigen. Damit war seine Methode
„kritisch und revolutionär.“
(Karl Marx, Das Kapital, Werke, Band 23, Dietz Verlag Berlin, 1960, S. 28)
Revolution ja – aber mit wissenschaftlichem Fundament
Diese revolutionäre Seite der Dialektik wurde von Anarchisten oft in destruktive Totalablehnung umgedeutet. Marx und Lenin hingegen verbanden den revolutionären Bruch mit einem klaren Verständnis vom notwendigen Übergang – etwa durch die zeitweilige Beibehaltung bürgerlichen Rechts im Sozialismus oder der Tatsache, dass es auch im Sozialismus nicht sofort mietfreies Wohnen geben kann (Engels).
Drei fundamentale Einsichten zur Rolle der Klassen
Schon vor Marx hatten bürgerliche Theoretiker Klassenkämpfe als Motor der Geschichte erkannt. Marx aber ging darüber hinaus. Er erkannte:
Klassen sind nicht ewig, sondern an bestimmte Entwicklungsstufen der Produktion gebunden.
Der Klassenkampf führt notwendig zur Diktatur des Proletariats.
Diese Diktatur wiederum ist nur eine Übergangsform auf dem Weg zur klassenlosen Gesellschaft.
Der Sozialismus – Ergebnis der ökonomischen Analyse
Damit wird deutlich: Für Marx war der Sozialismus keine moralische Idee, sondern ein historisch ableitbares Resultat ökonomischer Entwicklung. Die Kritik der politischen Ökonomie bildet deshalb den Kern des Marxismus-Leninismus.
Während bürgerliche Ökonomen die politische Ökonomie als „ewige“ Kategorie menschlichen Zusammenlebens betrachten, offenbart Marx, dass Ausbeutung, Konkurrenz und Klassengegensätze historisch bedingt – und überwindbar – sind.
Die Mehrwerttheorie – Herzstück der Ausbeutungskritik
Den entscheidenden Durchbruch erzielte Marx mit seiner Mehrwerttheorie. Die klassische Ökonomie hatte die Frage gestellt: Wie entsteht der Mehrwert? Oder zugespitzt: Wie funktioniert die bürgerliche Gesellschaft so, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden?
Marx’ Antwort war bahnbrechend: Der Kapitalist kauft auf dem Markt eine ganz besondere Ware – die Arbeitskraft. Ihr Gebrauchswert besteht darin, Wert zu schaffen. Und nur hier, im Konsum dieser Ware, entsteht neuer Wert.
Der Lohn deckt lediglich die notwendigen Lebenshaltungskosten des Arbeiters. Doch der Lohnarbeiter schafft darüber hinaus Mehrwert – unbezahlte Arbeit, die sich der Kapitalist aneignet. Diese Surplus-Arbeitszeit ist der Ursprung des Profits.
Kapitalismus im Endstadium – Der Imperialismus
Genau das ist der Kern kapitalistischer Ausbeutung – und das bleibt auch im Imperialismus so. Denn der Imperialismus ist keine eigene Gesellschaftsformation, sondern nur das höchste, reifste Stadium des Kapitalismus:
Ein Kapitalismus im Stadium seines Verfalls, aber eben doch Kapitalismus.
________________________
.
Ihr könnt dies Magazin unterstützen, indem ihr:
- Freunden, Bekannten, Kollegen und Gleichgesinnten
von diesem OnlineMagazin DER REVOLUTIONÄR erzählt; - Einen Link zu diesem Magazin an sie versendet;
- Die jeweiligen Beiträge teilt oder mit einem Like verseht;
- Eine Empfehlung in den sozialen Medien postet;
- Die Redaktion und Öffentlichkeitsarbeit durch Artikel,
Leserbriefe, Videoberichte und Kritiken unterstützt,
gerne auch als Gastartikel oder Volkskorrespondent; - Unsere Seite bei Facebook mit einem Like verseht;
(https://www.facebook.com/DerRevolutionaer).
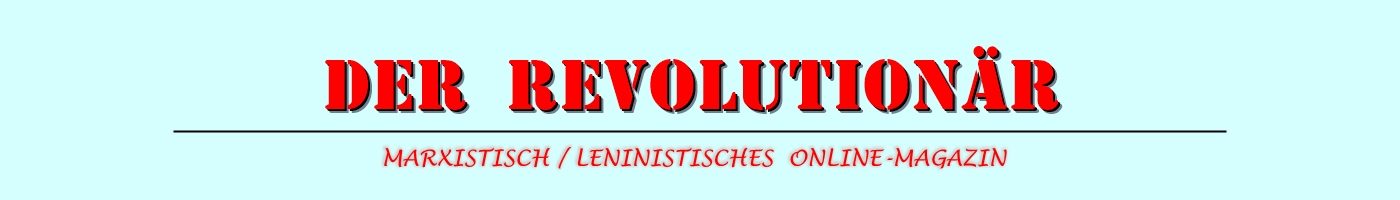




Hinterlasse jetzt einen Kommentar